Der sekundäre Katastrophengewinn
Zur entlastenden Funktion von Erdbeben
Wir schreiben das Jahr 1755. In weiten Teilen Europas herrscht die
„Aufklärung von oben“, gespeist durch einen emphatischen Vernunftbegriff.
Zeitgleich wird bereits Kritik am Absolutismus und Feudalismus laut, der
Begriff der Vernunft beginnt sich mit dem der Freiheit zu verschränken. Der
durch Hobbes´ „Leviathan“ 1651 eingeleitete Säkularisierungsprozess ist voll
im Gange. Und dann geschieht folgendes:
Am ersten November 1755 erschüttert ein Erdbeben die Stadt Lissabon. Als direkte
Folge gibt es eine Feuersbrunst und eine Flutwelle. Die Hautstadt Portugals wird
nahezu vollständig zerstört. Ca. 90.000 Menschen sterben dort, 10.000 weitere
in der Umgebung.
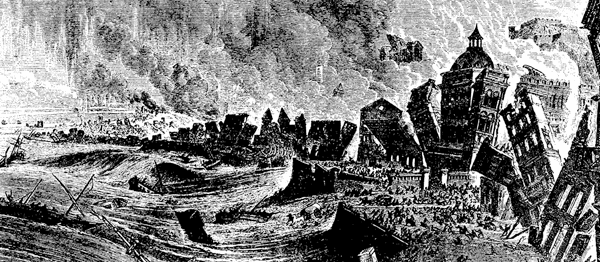
Der Schock konnte größer nicht sein. Die geistige Welt Europas reagierte
schnell. Immanuel Kant, Johann Wolfgang von Goethe, Jean Jacques Rousseau,
Heinrich von Kleist, Georg Christoph Lichtenberg, Voltaire, Johann Friedrich
Jakobi, Christoph Martin Wieland und viele andere nahmen Bezug auf das
Erdbeben. Freiheit und Vernunft wurde durch diese Katastrophe empirisch eine
Grenze gesetzt. Die vernünftige Gestaltung der Welt durch die Menschen
selbst war in die Schranken gewiesen. Die bis dahin emphatische Philosophie
der Vernunft wurde, angeführt durch Kant, in eine neue Phase, die der
Vernunftkritik, transformiert. In der „Kritik der reinen Vernunft“ trennt
Kant rigide das Reich der Natur, hier herrscht deterministischer
Kausalzusammenhang, vom Reich der Freiheit, das der menschlichen Person
zugesprochen wird, soweit sie nicht Naturwesen ist. Kant sah dies als
einzige Möglichkeit, den Begriff der Freiheit überhaupt noch zu retten. Das
kantsche „Ich“, wird so zur „transzendentalen Einheit der Apperzeption“
oder, etwas moderner formuliert, zum logischen Bedingungs-Ich. Nur dieses,
von aller Empirie enthobene Ich, ist vernünftig und frei. Und notabene:
Diese Abstraktionsmeisterleistungen, die Kant häufig unverstandenerweise
vorgeworfen werden, betrieb er eben nicht, um Vernunft und Freiheit radikal
abzulehnen, sondern um sie, nach dem Schock der Katastrophe von Lissabon, zu
retten. Das Erdbeben von 1755 führte bei Kant so zu einer Form der
Vernunftkritik, die nicht ins Irrationale glitt.
Im Folgenden will ich ein paar sozialpsychologische Gedanken über
Naturkatastrophen im Allgemeinen und Erdbeben im Speziellen anstellen, die
ebenfalls kritischer Philosophie verpflichtet sind, jetzt aber aus dem
Theoriezusammenhang der Kritischen Theorie der Gesellschaft kommen und sich
auf die heutige Rezeption von Naturkatastrophen im globalisierten
Kapitalismus beziehen.
Seit Karl Marx wissen wir, dass im Kapitalismus Krisen nicht derart
strukturiert sind, dass zu wenig Güter vorhanden sind, weil zum Beispiel
Sturm, Hagel und Regen ganze Ernten vernichtet haben, sondern umgekehrt,
weil zu viele Güter auf dem Markt sind, kommt die Wirtschaft ins Stocken.
Eine innerkapitalistische Wirtschaftskrise ist eine Überproduktionskrise.
Der Verkäufer, zum Beispiel von Reis, kann nicht mehr rentabel verkaufen,
wenn zu viel Reis auf dem Markt existiert. Ist der Arbeitsmarkt voll, gilt
ebenso, dass man für geleistete Arbeit immer weniger Geld bekommt oder
gleich arbeitslos wird und so selbst dazu beiträgt, dass die Löhne weiter
fallen. So kommt es zur seltsamen Situation, dass Menschen Mangel leiden,
weil zu viele Waren im Umlauf sind, und nicht wie in früheren Zeiten, weil
Naturkatastrophen sie vernichtet haben.
Die heißen Kriege erwiesen sich im 20. Jahrhundert als effizienteste
Möglichkeit, die immer wieder auftretenden Überproduktionskrisen in den
Griff zu bekommen. Die riesige Vernichtung von Menschen (Ware Arbeitskraft)
und Sachen (Infrastruktur) in diesen Kriegen, führte dann zu anschließenden
wirtschaftlichen Wachstumsphasen. So fußte das Wirtschaftswunder der
Nachkriegszeit in Westdeutschland eindeutig auf der vorhergegangenen, durch
das Hitlerregime verursachten, grauenhaften Vernichtung. Von einer Stunde
Null zu sprechen oder gar davon, dass die soziale Marktwirtschaft in
Westdeutschland ausschließlich das Resultat der ach so klugen Gedanken eines
Herrn Ludwig Erhard gewesen sei, verschleiert diesen fürchterlichen
Zusammenhang.
So notwendig sich die Zerstörung der Überproduktion durch Kriege im
ökonomischen System darstellt, so problematisch ist sie im moralischen. Die
Vernichtung von Menschen und Sachen gilt in diesem Zusammenhang als sehr
heikel. Deswegen bekommen heutige Krieg führende Regierungen auch stets
Begründungsschwierigkeiten, was ihre Kriege anbelangt. Schon wer die
ökonomische Notwendigkeit von Kriegen einfach benennt (wie ich das hier
mache), auch wenn er sie, im Gegensatz zu vielen Regierenden, überhaupt
nicht gutheißt, muss sich schnell vorwerfen lassen, er sei ein
menschenverachtender Zyniker. Der Verweis, dass man auf die Notwendigkeit
von Kriegen in kritischer Absicht verwiesen hätte, und nicht weil man sie
toll findet, wird vor lauter Ressentiment meist gar nicht mehr wahrgenommen.
Im Verhältnis von Ökonomie und Moral zeigt sich so ein zentraler
gesellschaftlicher Widerspruch. Das moralische System von heute schreibt
vor, sich „political correct“ auszudrücken und verhindert nicht selten
dadurch, was es eigentlich erreichen will – statt zu einer gerechteren und
humaneren Welt zu kommen, führt die Ideologie der Political Correctness
nicht selten dazu, dass wahrheitsgemäße Zusammenhänge, die in kritischer
Absicht genannt werden, nicht mehr ausgedrückt werden dürfen. Das
Sauberwerden der offiziellen Sprache ist dann logisch verknüpft mit der
Verschleierung gesellschaftlicher Widersprüche. Sprache, Propaganda und
Unwahrheit fallen dann zusammen.
In der Sprache der Political Correctness drückt sich das schlechte Gewissen
der Menschen aus, die ahnen, dass die meisten heutigen Katastrophen, zum
Beispiel die generelle Verarmung ganzer Bevölkerungsschichten weltweit, im
Speziellen das Wegbrechen der Mittelschichten und die zunehmende Kinderarmut
in der ersten Welt, Elend, herbeigeführt durch Kriege usw.,
gesellschaftliche Ursachen haben, also Katastrophen der so genannten zweiten
Natur sind.
Für das Schreckliche will der Mensch aber nicht gern Ursache sein, doch wie
wird man auf „saubere Art“ die die Wirtschaft hemmende Überproduktion los?
Und hier kommt vielleicht die eine oder andere Naturkatastrophe den nicht
direkt Betroffenen durchaus zupass. Endlich passiert mal eine Katastrophe,
die die wirtschaftlich notwendige Vernichtung praktiziert, ohne dass man
sich schuldig fühlen muss. Sind gesellschaftlich bedingte Katastrophen für
die Herrschenden moralisch immer heikel, sind es Naturkatastrophen, also
solche der ersten Natur, erst einmal nicht.
So ist es nicht verwunderlich, dass den Opfern einer Naturkatastrophe meist
mehr Zuwendung durch Spenden zuteil wird, als wenn wieder mal ein
Flüchtlingsstrom, ausgelöst durch Stammeskämpfe, Rassenunruhen und daraus
resultierender Armut und Existenznot, sich von Afrika Richtung Mittelmeer
und Europa bewegt. Man erinnere sich nur an durch Spenden organisierte
Hilfsaktionen nach dem Tsunami vom Dezember 2004, die ja doch beachtlich
waren. Den afrikanischen Flüchtlingen dagegen droht man mit dem Bau von
Flüchtlingslagern, die ihr Elend lediglich verlängern und verlagern.
Im Extremfall einer Naturkatastrophe im Sinne der ersten Natur, wird so den
direkt betroffenen Opfern eine Menschlichkeit zuteil, die sie sonst nicht
bekommen würden. Für den Normalfall menschlichen Lebens gilt die alte
liberale Ideologie, jeder sei seines Glückes Schmied, und wer in Armut und
Existenznot gerät, sei selber schuld. Diese bürgerliche Kälte gerät
allerdings momentan etwas ins Wanken. Man könnte von einem dialektischen
Umschwung in diesem Sinne sprechen, dass eine zunehmende Quantität in eine
neue Qualität umzuschlagen beginnt. Immer mehr Menschen, gerade in den
entwickelten Industrieländern, geraten in prekäre Lebenssituationen. Dies
hängt mit der immensen Zunahme ökonomischer Konkurrenz im globalisierten
Kapitalismus seit dem Ende des kalten Krieges zusammen. Zwar ist im
Bewusstsein der im Kapitalismus sozialisierten Menschen sehr wohl die oben
angesprochene Ideologie des Liberalismus tief verankert, doch ahnen immer
mehr Menschen, dass bei der großen Zahl nicht alle Arbeitslosen und zur
Klasse der Working Poor gehörigen, bloß faule Säcke sein können. Morgen kann
es einen bereits selbst treffen. Das eigene Elend oder die Angst davor,
verursacht durch spezifische gesellschaftliche Verhältnisse, die als
Sachzwang erlebt werden, erinnert die Menschen immer wieder daran, dass sie
diese Verhältnisse, die sich prinzipiell ändern lassen, selbst am Leben
erhalten. An den geltenden gesellschaftlichen Verhältnissen, sofern man sie
affirmiert, ist man in der Tat selbst schuld und damit auch zum Teil an
seiner eigenen prekären Situation.
Das wunderbar Entlastende der Naturkatastrophe im Sinne der ersten Natur ist,
dass sie einen an nichts erinnert, vor allem nicht an eine mögliche eigene Mitschuld.
Sie ist rein.
Bei genauem Betracht freilich zeigt sich, dass die Differenz von
Katastrophen der ersten und solchen der zweiten Natur zwar grundsätzlich
richtig ist, sich aber nicht in allen Punkten durchhalten lässt. Denn setzt
nach einer Naturkatastrophe die Hilfe nicht rechtzeitig ein, oder ist sie
schlecht organisiert, wie zum Beispiel 2005 bei der Flut in New Orleans,
dann verschlimmert sich der durch die Natur verursachte Zustand durch einen
durch Menschen verursachten. Außerdem wirkt sich der allgemein gültige,
schlichte, liberale Grundsatz, wer genügend Geld hat, kann angenehm leben,
wer nicht, der nicht, auch auf die ungleiche Verteilung der Last negativer
Folgen zum Beispiel von Erdbeben aus. In diesem Zusammenhang lautet er: Wer
reichlich Geld hat, kann erdbebensicher bauen, wer nicht, der nicht. Die
ungleichen Folgen von Naturkatastrophen sind gesellschaftlich bestimmt. Und
warum errichten eigentlich Menschen Städte an Orten, die bekanntermaßen
extrem erdbebengefährdet sind, wie zum Beispiel San Francisco? Und außerdem
gibt es bei vielen so genannten Naturkatastrophen mittlerweile insofern eine
Mitschuld des Menschen, da angenommen werden muss, dass von Menschen
verursachte Umweltverschmutzungen zu Klimaveränderungen beitragen. Die
daraus resultierende erhöhte Erderwärmung führt dann zu einer Zunahme von
schweren Stürmen.
Und da zeigt sich dann doch wieder ein Vorteil bei den Erdbeben: Diese
lassen sich weitaus weniger leicht als von den Menschen mitverschuldet
nachweisen, als zum Beispiel Katastrophen, die durch Wirbelstürme verursacht
wurden. Die entlastende Funktion der nicht direkt Betroffenen ist dadurch
bei Erdbeben erheblich stärker.
Während Kant immerhin Vernunft und Freiheit transzendentalphilosophisch noch
retten wollte, haben sich die Menschen heute sozialpsychologisch
offensichtlich derart eingerichtet, dass sie die Katastrophen der ersten
Natur brauchen, um die der zweiten auszuhalten.
Prof. Dr. Thomas Friedrich lehrt Designtheorie und Philosophie an der
Fakultät Gestaltung der Hochschule Mannheim. Er leitet das dortige Institut für
Designwissenschaft.